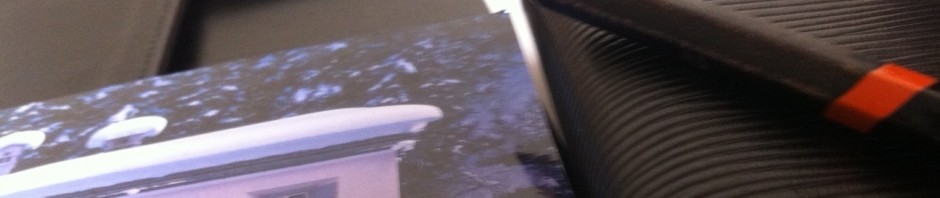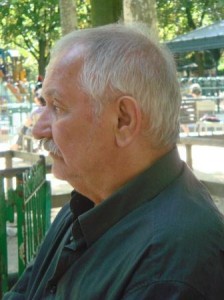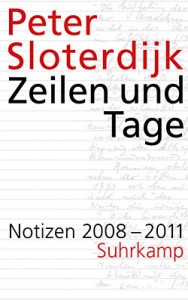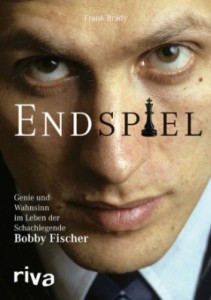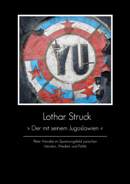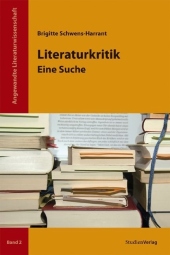Über den notorischen Außenseiter Gerd-Peter Eigner
Ein volkstümliches Diktum besagt, daß zum Streiten zwei gehören. Es dient oft als bequemer Vorwand, um sich die genauere Prüfung eines Konflikts und, in der Folge, die Parteinahme zu ersparen. Zunächst aber kommt man um die Feststellung der Trivialität nicht herum, will man die Mechanismen eines Streits begreifen. Um ihr Spiel spielen zu können, sind beide Seiten aufeinander angewiesen: so ist das bei Kindern und Erwachsenen, zwischen Kritikern und Konservativen, zwischen der Gesellschaft und ihren Außenseitern. Ein solcher ist der deutsche Schriftsteller Gerd-Peter Eigner seit jeher, mit großer Konsequenz, bis ins Alter. Außenseiter aus freiem Entschluß und »durch die Gesellschaft«, wie Antonin Artaud seinerzeit formulierte.Eigner habe ich in den frühen achtziger Jahren in Salzburg kennengelernt, wir waren viele Stunden in Pariser Cafés und Bars oder auf den Straßen der Stadt zusammen. An einen Besuch in einem Bergdorf hoch über Nizza, wo ich damals die Sommer verbrachte, kann ich mich erinnern, und ebenso an die Gänge und Fahrten (auf dem Vespa-Rücksitz) zu seinem Winzerhäuschen in den Monti Prenestini über Rom. Es hat sich mir oft bestätigt, was auch die Lektüre seiner Bücher verrät: Der Mann besitzt ein angeborenes Talent, Leute zu verstören, Unmut auf sich zu ziehen und sich in unhaltbare Lagen zu bringen. Weiterlesen